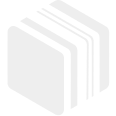Selbstwirksamkeitserwartung im Leistungssport

Was ist Selbstwirksamkeitserwartung überhaupt?
Der Begriff „Selbstwirksamkeitserwartung“, auch genannt „Kompetenzerwartung“, definiert sich als die subjektive Gewissheit einer Person, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund der eigenen Kompetenz bewältigen zu können. Dabei werden diese Anforderungssituationen nicht mit Aufgaben, die durch einfache Routine zu lösen sind gleichgesetzt. Vielmehr sind Lebenssituationen gemeint, die nur durch Ausdauer und Anstrengung bewältigt werden können (Schwarzer, 2004, S.12). Beispiele dafür sind das Ziel, einen Marathon laufen zu können oder im Hochleistungssport die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu erreichen.
Vor allem das Überwinden von Barrieren durch die eigene Intervention kommt bei der Selbstwirksamkeitserwartung zum Ausdruck. So könnten Selbstwirksamkeitsgedanken zum Beispiel folgendermaßen lauten: „Ich bin sicher, dass ich heute auch laufen gehe, wenn es draußen regnet.“ Wenn keine oder wenig Selbstwirksamkeitserwartung vorhanden ist, lässt dies Menschen oft initiativlos werden oder veranlasst sie, vorzeitig aufzugeben (Jerusalem & Hopf, 2002, S.8-39).
Selbstwirksamkeit im Laufsport
Gerade im Laufsport werden sportliche Leistungen an Zeiten festgemacht. Das heißt, es gilt, eine neue persönliche Bestzeit aufzustellen, die Norm auf nationaler oder internationaler Ebene zu erfüllen oder sich untereinander zu vergleichen. Dabei können Zeitlimits schnell zu unüberwindbaren Barrieren werden. Und das vor allem im Kopf!
Um den Zusammenhang von Selbstwirksamkeitserwartung und sportlicher Höchstleistung zu verdeutlichen, soll folgendes Beispiel angebracht werden: Lange Zeit nahm man an, dass der menschliche Organismus nicht in der Lage sei, die „4 Minuten Barriere“ auf einer Meile zu brechen. Es wurde vermutet, dass der menschliche Organismus nicht in der Lage sei, diese Zeit zu unterbieten. Im Jahre 1954 hat dann der Engländer Roger Bannister diese Annahme widerlegt und lief die Meile in 3:59,4 Minuten. Nachdem sich die Nachricht dieser Höchstleistung verbreitet hatte, folgte eine Verbesserung des Rekordes auf den anderen (Brandura 1997, S.396). Ein ähnliches Beispiel ist der inoffizielle Rekordversuch 2019 von Eliud Kipchoge, bei dem die zwei Stunden bei einem Marathon unterboten wurden. Diese Grenze hätte er ohne eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung nicht verschieben können.
Deutlich wird: Für das Erbringen einer sportlichen Höchstleistung sind vor allem die psychischen Barrieren entscheidend. Im Falle von Roger Bannister haben sich die anderen Athleten mit ihm verglichen und so ihre eigene Selbstwirksamkeitserwartung erhöht. So war es auch für sie möglich, diese Leistung zu erbringen. Klar ist auch, dass jeder Leistungssportler eine überdurchschnittlich hohe Selbstwirksamkeit aufweist. Ansonsten wären der hohe Trainingsaufwand, Verzicht und Disziplin nicht in dem Ausmaß möglich (Jerusalem & Hopf, 2002, S.38).
Schwarzer, R. (2004). Psychologie des Gesundheitsverhaltens Einführung in die Gesundheitspsychologie (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.Jerusalem, M. & Hopf D. (2002, Mai). Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik, 44, 8-200.Brandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York : W.H. Freeman Collection inlibrary.