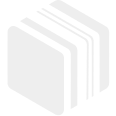Sportveranstaltung ist nicht gleich Sportwettkampf - Oder doch?

Sportlern und Veranstaltern** haben mit Sicherheit keine einfache Zeit hinter sich und auch jeder noch so kleine Hoffnungsschimmer auf Normalität war häufig nur das, ein Schimmer am Horizont. Was das mit Athleten, Veranstaltern oder Trainern macht wurde an anderer Stelle häufig beschrieben und soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Allerdings soll dieser Beitrag durchaus dazu beitragen zu erklären, dass nicht jedes Sportfest gleich ein Wettkampf im rechtlichen Sinne ist und dass nicht jeder Leistungssportler gleich Profi ist und damit unter den grundgesetzlichen Schutz der Berufsfreiheit fällt. In der Diskussion aber auch der Berichterstattung werden die Begriffe oftmals synonym verwandt, was im Umkehrschluss dann zu verständlicher Verunsicherung und Verärgerung führen kann. Daher soll hier versucht werden etwas Klarheit in den juristischen Dschungel zu schlagen.
Sportfest, Sportveranstaltung oder Sportwettkampf?
Wichtig und nicht ganz trivial ist die Unterscheidung, ob ein Termin als Sportfest, Sportveranstaltung oder Sportwettkampf einzustufen sind. Da der Gesetzgeber und die Rechtsprechung keinen der Begriffe bisher legeldefiniert haben, herrscht bis zu einem gewissen Punkt eine Rechtsunsicherheit und kann es zu Überschneidungen insbesondere zwischen Sportfest und Sportveranstaltung kommen.
Anhaltspunkte für einen Wettkampf finden sich jedoch in der Gesetzesbegründung zum Anti-Doping-Gesetz (AntiDopG) von 2017. Dieses besagt, dass ein Wettkampf ein Wettbewerb des organisierten Sports ist und kumulativ dazu der Wettbewerb von einem nationalen oder internationalen Sportverband oder in deren Auftrag oder mit deren Anerkennung organisiert sein muss
und
in dem Wettbewerb die Regeln eingehalten werden müssen, die von der nationalen oder internationalen Sportorganisation (z.B. DLV) verpflichtend für alle Mitglieder verabschiedet wurden.
Ein Wettkampf im rechtlichen Sinne sind also zweifelsfrei die Olympischen und Paralympischen Spiele, Welt- und Europameisterschaften, die Deutschen Meisterschaften oder aber auch ein organisierter Ligabetrieb. Die wohl aktuell herrschende Literaturmeinung schließt im Übrigen auch solche Wettkämpfe aus, die nur von lokalen oder regionalen Sportorganisationen (z.B. HLV, BLV, LVR, etc.) durchgeführt oder anerkannt werden. Ab hier beginnt es jedoch weiter ungenau zu werden, da auch jetzt wiederum Ausnahmen greifen. Sofern nämlich eine nationale oder internationale Sportorganisation einen anderen (regionalen Sportverband oder Dritte) im Voraus beauftragt, einen Wettkampf zu organisieren und durchzuführen, handelt es sich hierbei um einen Wettkampf des organisierten Sportes. Eine Veranstaltung, obgleich stadionnah oder stadionfern, könnte demnach an eine nationale oder internationale Meisterschaft herangerückt werden, da sie dann als Wettbewerb des organisierten Sportes gilt, wenn sie von einer nationalen Sportorganisation zur Durchführung in Auftrag gegeben oder im Vorfeld anerkannt wurde. Diese Anerkennung oder Beauftragung wird sich im Einzelfall jedoch nach den Statuten der jeweiligen nationalen oder internationalen Sportorganisation bemessen. Grundsätzlich ist es somit denkbar, dass Firma K nach vorheriger Beauftragung oder Anerkennung der Veranstaltung durch den Y-Verband einen Wettbewerb des organisierten Sportes durchführt, was dann einen Wettkampf darstellt.
In Abgrenzung zu Wettbewerben des organisierten Sportes/Wettkämpfen nach § 3 AntiDopG werden Sportveranstaltungen als Veranstaltungen rein privater Natur ohne mittelbare oder unmittelbare Anbindung an eine nationale oder internationale Sportorganisation angesehen. Eine Sportveranstaltung liegt selbst dann vor, wenn die Regeln der nationalen oder internationalen Sportorganisation auf sie Anwendung finden, z.B. im Schulsport, bei Freizeitturnieren oder bei Sportfesten, wenn diese nicht die Voraussetzungen wie oben beschrieben erfüllen. Als weiteres Abgrenzungskriterium werden zudem die Leistungsfähigkeit bzw. Zielsetzung der Teilnehmer herangezogen. Wenn die Teilnehmer nicht notwendigerweise um Sieg und Niederlage kämpfen, sondern die eigene körperliche Ertüchtigung oder die Unterhaltung eines Publikums im Vordergrund stehen, soll es sich nicht um einen Wettkampf handeln. Der Wettbewerb stellt dann eine dem Privaten zuzurdnende Sportveranstaltung dar (auf die im Übrigen das AntiDopG auch keine Anwendung findet).
Die Trennlinie zwischen Sportveranstaltung und Wettbewerb des organisierten Sportes ist daher unscharf und wird aus verfassungsrechtlichen Gründen seit der Einführung des AntiDopG wohl auch zurecht kritisiert. Zumal kann das Kriterium der Professionalität wohl nicht als Unterscheidungsgrund herangezogen werden.
Zwischenfazit
Dennoch lässt sich eine Einteilung in Wettkampf und privater Sportveranstaltung dem Grunde nach vornehmen. Inwiefern Entscheidungen rechtlich standhalten, muss jedoch im Einzelfall geprüft werden und ist ohne Kenntnis des Sachverhalts nicht ohne Weiteres möglich. Auch wenn im Volksmund und teilweise auch in der Literatur und Rechtsprechung die Begriffe synonym gebraucht werden, können sie im Einzelfall eine deutlich unterschiedliche Bedeutung haben.
Profi-Sport oder Leistungssport: Eine Frage von Liebhaberei?
Ebenfalls interessant, jedoch für die o.g. Diskussion nur von untergeordneter Relevanz ist die Unterscheidung, ab wann denn Leistungssport als Profi-Sport anzusehen ist und ggf. Eingriffe, also Einschränkung von Freiheitsrechten, verfassungsrechtlich schwieriger ist, als bei leistungsorientierten Amateursportlern. Die sog. Liebhaberei aus dem Steuerrecht lässt eine Tätigkeit grdsl. solange außer Acht, wie sie nur aus "Jux und Tollerei" geschieht nicht jedoch in eine sichere Erwerbstätigkeit mündet. Deshalb sind die Kosten für Laufschuhe, Rennrad oder Trainingslager des Filius auch dann nicht steuerrechtlich anzuerkennen, wenn er damit ein paar Euro verdient oder einige Jahre später sogar einen € 1 Mio.-Deal mit einem großen Sportartikelhersteller (oder Rennstall) unterzeichnet. An dieser Stelle hat der Gesetzgeber jedoch tatsächlich Nachsicht mit dem Rechtsanwender walten lassen und in § 265d StGB klarere Kriterien daran angelegt, ab wann Berufssport vorliegt.
Berufssport liegt dann vor, wenn eine Sportveranstaltung im In- oder Ausland von einer nationalen oder internationalen Sportorganisation selbst oder in deren Auftrag oder mit vorheriger Anerkennung organisiert wurde, dabei ihre verpflichtend verabschiedeten Regeln einzuhalten sind und wenn überwiegend Sportler teilnehmen, die durch ihre sportliche Betätigung unmittelbar oder mittelbar erhebliche Einnahmen erzielen (wollen). Wenn es sich also um einen Wettbewerb handelt, bei dem mindestens 50% der Teilnehmer aus ihrer sportlichen Leistung unmittelbar oder mittelbar Einkünfte erzielen wollen. Um damit als Berufssportler bzw. als Teilnehmer an einem Berufssportlichen Wettbewerb zu gelten müssen diese Einnahmen auch die bloßen Kosten, die entstanden sind, mehr als nur unwesentlich übersteigen. Allerdings werden neben Antritts- und Siegprämien auch sonstige Förderungen einbezogen, aus denen ein finanzieller Vorteil entsteht. Nicht erforderlich ist es offenbar jedoch, dass die hierdurch bezogenen Einkünfte zur Deckung des Lebensunterhalts ausreichend sind. Indizwirkung dürfte indes sicherlich eine Kaderzugehörigkeit haben, wobei auch ohne diese die Umstände des Einzelfalls ausschlaggebend sind, um den Status des Berufssports zu begründen oder zu widerlegen. Athlet A, dem regelmäßig für die Teilnahme Kosten in Höhe von € 200 entstehen und der durch Start-/Siegprämien € 220 einnimmt wird daher wohl nicht als Berufssportler einzuordnen sein. Athlet B, der ebenfalls am selben Wettbewerb teilnimmt und dem regelmäßig für seine Teilnahme Kosten in Höhe von € 450 entstehen und der durch die Förderung eines Sportartikelherstellers, eines lokalen Hotelliers und seines Verbandes Einnahmen von € 600 erzielt könnte dagegen durchaus als Berufssportler zu bewerten sein.
Eine Differenzierung in und Ungleichbehandlung von Berufssportlern und leistungsorientierten Amateursportlern erscheint daher gerechtfertigt und nicht weiter problematisch zu sein. Allerdings sind hier, wie fast immer in diesem Rechtsgebiet, einige Unsicherheiten verbunden, weshalb es auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. Das Kriterium der wesentlichen Einnahmen wird darüberhinaus auch als zu unbestimmt kritisiert, scheint sich jedoch durchzusetzen und die Gewinnerzielungsabsicht als taugliches Abgrenzungsinstrument zum Amateursport hinzuhalten.
Vergleich und Schlussbemerkung
Die Differenzierung zwischen den aktuell diskutierten Begriffen ist freilich nicht leicht und die Abgrenzung wird in der Literatur teilweise scharf kritisiert. Deshalb wird wohl immer im Einzelfall danach zu fragen sein, welcher Aspekt des sportlichen Wettbewerbs vorliegend dominiert. Nichtsdestotrotz ist eine Unterscheidung in Berufssport und Amateursport möglich und auch losgelöst von Kaderzugehörigkeiten möglich. Neben des organisierten Wettbewerbs ist die Absicht entscheidend mittelbar oder unmittelbar mit dem Sport Einkünfte zu erzielen.
Strittig und ohne Lösung bleibt jedoch die Frage auf welcher Grundlage sportlicher Wettkampf in unteren Ligen von behördlicher Seite erlaubt wird, wohingegen Veranstaltungen mit dem Ziel, die Teilnahme an nationalen oder internationalen Meisterschaften zu ermöglichen (z.B. Qualifikationswettkämpfe mit abgestuften Kontingenten an Startplätzen) von behördlicher Seite untersagt werden. Spannend wäre an dieser Stelle sicherlich, ob eine Genehmigung auch dann versagt würde, wenn der nationale Fachverband die lokalen Veranstalter mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragen würde. Jedenfalls bleibt ein Beigeschmack zurück, wenn Absagen schlecht oder unzureichend begründet werden und parallel Veranstaltungen mit deutlich größerem Infektionsrisiko stattfinden dürfen. Und es bleibt Unsicherheit, die für Sportdeutschland einen viel größeren Schaden bedeuten könnte als dies gut geplante Veranstaltungen mit Hygienekonzept je könnten.
* Der hier veröffentlichte stellt keine Rechtsberatung dar! Der Verfasser befasst sich im Rahmen seines LL.M Studiums u.a. mit Fragen des Sportrechts, weshalb der vorliegende Text nur zu Diskussionszwecken verwendet werden kann. Es handelt sich hierbei um eine wissenschaftliche Stellungnahme zur aktuellen Situation. Es wird dringend empfohlen eine Rechtsberatung bei einem auf Sportrecht spezialisierten Rechtsanwalt in Anspruch zu nehmen.
** Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit verwendet der Verfasser das generische Maskulinum. Hiervon sind ausdrücklich alle Sportler*innen und Veranstalter*innen erfasst :-)
*** Auf Anfrage können die bei der Recherche zu diesem Artikel verwandten Quellen und Medien zur Verfügung gestellt werden. Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wurde auf die Quellenangabe im Einzelnen hier verzichtet.