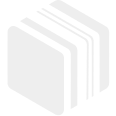What it takes – schlägt Fleiß Talent?


Wie viel Talent braucht man, um zum Weltklasseläufer aufzusteigen und wie viel fehlendes Talent lässt sich mit Fleiß kompensieren? Geht es nach dem bekannten Motivationssong „Remember the name“ von Fort Minor, spielen viele Faktoren - insbesondere eine gehörige Portion „Schmerz“ - eine Rolle:
„This is ten percent luck -
Twenty percent skill -
Fifteen percent concentrated power of will -
Five percent pleasure -
Fifty percent pain -
And a hundred percent reason to remember the name“
Auch ich bin nach vielen Jahren im Profisport überzeugt, dass sich am Ende nur diejenigen durchsetzen, die mit einem runden Gesamtpaket aus Talent, Fleiß und einem stabilen Umfeld aufwarten können. Sich diese Kombinationen genauer anzuschauen, finde ich äußerst spannend, da die Erfolgskonzepte so unterschiedlich sind, wie die Spitzenathleten selbst. Im Spannungsfeld zwischen anatomischem Talent, mentaler Stärke und Umfeld können die Prioritäten individuell gesetzt werden, sodass bei Olympischen Spielen nicht nur die Athleten mit dem größten Talent vorne landen, sondern man sich auch mit Fleiß, einer smarten Rennstrategie und einem starken Unterstützerteam im Rücken weit nach vorn katapultieren kann.
Um diese verschiedenen Pole greifbarer zu machen, lohnt sich ein Blick auf die Laufkultur in den westlichen Ländern, Ostafrika und Japan, da sie – ohne zu sehr verallgemeinern zu wollen – sinnbildlich für jeweils einen dieser drei Schwerpunkte stehen.
Laufen in Ostafrika: Talent pur
Weniger ist mehr. An kaum einen Ort auf dieser Welt trifft dieses Motto so sehr zu wie in Kenia. Schlichte Wellblechhütten, eine monotone, aber äußerst gesunde Ernährung, wenig Geld und die Notwendigkeit, schon als Kind den Weg zur Schule zu Fuß zurücklegen zu müssen, sind eine verborgene Stärke der afrikanischen Laufkultur. Wenn Einfachheit auf pures Talent trifft, wird die Grundlage für neue Weltrekorde gelegt. Es ist auch nach neun langen Aufenthalten in Kenia für mich immer wieder erstaunlich, die faszinierende Anatomie der ostafrikanischen Läufer aus nächster Nähe zu sehen. Beine wie Streichhölzer, Wadenmuskulatur, die gefühlt in der Kniekehle entspringt und ein perfektes Kraft-Last-Verhältnis: Die Körper vieler kenianischer Läufer sind wie geschaffen für den Laufsport.
Da die Aufstiegschancen in dem recht armen Land limitiert sind, bildet das professionelle Laufen einen attraktiven Weg zu mehr Wohlstand, sodass die Motivation der Athleten oft enorm hoch ist. Gepaart mit den idealen Trainingsbedingungen im afrikanischen Hochland und einem herausfordernden Gelände überrascht es kaum, dass die Dichte der kenianischen und äthiopischen Topläufer so enorm ist. Während das anatomische Talent der ostafrikanischen Läufer sicher ihr größtes Faustpfand ist, zahlen die geografischen Gegebenheiten und die schiere Masse an Talenten auch auf die Umfeld-Komponente ein, da sich an den kenianischen Hotspots beeindruckende Trainingsgruppen von bis zu 200 Leuten auf Topniveau bilden. Solche Dimensionen sind an anderen Orten auf der Welt kaum vorstellbar und die starken Trainingsgruppen forcieren die Leistungsentwicklung im ostafrikanischen Laufsport, doch der Selektionsdruck in diesen häufig unstrukturierten Systemen ist enorm. Es gilt: Wer hier besteht, besteht überall auf der Welt.
Stärken: anatomisches Talent, Vielzahl an Trainingspartnern, klimatische Bedingungen, Höhenlage, Motivation durch prekäre Lebensbedingungen, sportfreundliche Sozialisierung, gesellschaftliches Ansehen
Schwächen: materielle Versorgung, medizinische Versorgung, wissenschaftliches Know-How bei der Trainingssteuerung, enormer Selektionsdruck, durch den viele Talente auf der Strecke bleiben, schwache institutionelle Förderstrukturen
„Mentalitätsmonster“ aus Japan
Pure Willenskraft und eine Arbeitermentalität, die ihresgleichen sucht: Die japanischen Läufer lassen sich häufig mit Fug und Recht als Mentalitätsmonster bezeichnen. Sie sind für furchteinflößende Trainingsumfänge von bis zu 300 Kilometern pro Woche bekannt und verbinden dieses extreme Training oft noch mit einer regulären beruflichen Tätigkeit. Laufen ist in der japanischen Kultur traditionell so fest verankert wie bei uns Fußball und verkörpert die in Japan hoch angesehenen Ideale wie Disziplin, Fleiß und Selbstkontrolle.
Als Resultat der gesellschaftlichen Vorbildfunktion der Läufer verfügt Japan über eine Dichte an Weltklasseläufern, die sonst nur in Kenia und Äthiopien existiert. Selbst bei einzelnen Marathonläufen in Japan bleiben regelmäßig dutzende Läufer unter der 2:10 Stunden-Marke. Häufig starten diese Spitzenathleten für japanische Konzerne und erhalten von ihnen eine gewisse finanzielle Unterstützung. Harte Arbeit und eiserne Disziplin sind das Geheimnis hinter dem japanischen Erfolg im Laufsport, bergen gleichzeitig aber auch das Risiko, die Talente zu verheizen.
Stärken: kultureller Stellenwert des Laufsports, Ideale der japanischen Kultur für Marathonläufer optimal, hohe Leistungsdichte, Förderangebote durch Konzerne
Schwächen: Tendenz zur Überforderung, nationale Ausrichtung der meisten Athleten, schwieriger Zugang zu Höhentraining
USA und Europa: Gute Förderung und viel Knowhow
Ein eher strategischer Ansatz wird in den westlichen Strukturen in Europa und den USA verfolgt. Insbesondere die USA ziehen ihre Stärke aus ihrem enorm starken Fördersystem rund um den Collegesport, in dem Talente mit attraktiven Stipendien in die Laufteams der Universitäten gelockt werden. In diesen stabilen und professionellen Unistrukturen mit millionenschwerer Wohlfühl-Ausstattung reifen dutzende Talente zu aussichtsreichen Profis, die dann häufig von professionellen Laufteams mit Rückendeckung zahlreicher großer Sportartikelhersteller übernommen werden.
In diesen Teams mit professionellen Trainern, optimaler medizinischer Versorgung, wissenschaftlicher Leistungsdiagnostik und daran orientierten Trainingsplänen, Höhentrainingslagern und starken, aber relativ wenigen, Trainingspartnern werden die Profis strukturiert an den Sprung ins Nationalteam herangeführt. Ähnliche Ansätze existieren auch im Rahmen des Militärs, wie zum Beispiel hierzulande durch die Bundeswehr-Sportfördergruppen, mit deren Unterstützung die deutschen Topathleten finanzielle und medizinische Rückendeckung für das Erreichen der Weltspitze erhalten. Eng verzahnt ist dieses Fördersystem mit den deutschen Olympiastützpunkten, an denen den Athleten eine möglichst optimale Infrastruktur für ihr Training geboten wird. Oft geht es aber selbst an den Stützpunkten recht einsam zu, sodass sich viele Lauftalente insbesondere in Europa auf sich selbst besinnen müssen oder den Sprung ins amerikanische Collegesystem gehen.
Stärken: über Jahrzehnte gewachsene Förderstrukturen, wissenschaftliches Knowhow in der Trainingssteuerung, materielle Versorgung
Schwächen: anatomisches Talent weniger ausgeprägt als in Afrika, geringe Leistungsdichte und Trainingspartner, Sozialisierung oft nicht sportfreundlich, schwieriger Zugang zu Höhentraining
Das Beste aus allen Welten vereinen
Wirft man einen genaueren Blick auf die erste Reihe der internationalen Spitzenläufer, fällt schnell auf, dass viele von ihnen in allen drei Bereichen gut aufgestellt sind. So kombinieren kenianische Spitzenläufer wie Eliud Kipchoge die Einfachheit der afrikanischen Laufkultur mit dem organisatorischen und wissenschaftlichen Knowhow europäischer Manager. Im Rahmen des NN Running Teams trainieren diese Profis zwar weiterhin im heimischen Hochland und führen trotz ihres mittlerweile enormen Wohlstands das einfache und bescheidene Leben fort, profitieren aber enorm von den professionellen Campstrukturen, den guten Organisationsstrukturen ihres europäischen Managements und einer ausreichenden Versorgung mit Produkten. Bei meinen Aufenthalten in Kenia fiel mir schnell auf, dass fast alle international erfolgreichen Athleten bei einem internationalen Management unter Vertrag waren, während viele andere talentierte Athleten oft völlig ohne Struktur, ohne fundierten Trainingsplan und mit völlig durchgelaufenen Schuhen ihr eigenes Ding machten.
Auch bei der Einstellung und Disziplin habe ich erhebliche Unterschiede zwischen den „Outsidern“, die bislang noch nicht den Sprung zu internationalen Rennen geschafft haben, und den Profis mit internationalem Management festgestellt. Der Druck, aus einer gemanageten Gruppe herauszufallen und damit Zugang zu internationalen Wettkämpfen zu verlieren, scheint so hoch zu sein, dass im Training kaum geschludert wird. Viele meiner weniger professionellen Trainingspartner in Kenia sind ab und zu mal für mehrere Wochen verschwunden und völlig außer Form zurückgekehrt.
Während die medizinische Versorgung und materielle Ausstattung europäischer Athleten häufig gut ist, mangelt es hier oft an starken Trainingspartnern und vor allem im Winter an geeigneten klimatischen Bedingungen für professionelles Training. So sind Höhentrainingslager in Kenia für westliche Athleten mittlerweile häufig ein zentraler Bestandteil ihrer Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe. Insbesondere bei der Trainingssteuerung treffen dann häufig Welten aufeinander, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Beim Versuch, gemeinsam mit einer kenianischen Trainingsgruppe ein strukturiertes, an Zeiten orientiertes Training umzusetzen, sind wir oft kläglich gescheitert, da die Mentalität der einheimischen Läufer in vielen Fällen komplett anders war und Tempotrainings gerne als Ausscheidungsrennen ohne Rücksicht auf Verluste oder den Gedanken an den nächsten Trainingstag betrachtet wurden. Insbesondere für die oft weniger talentierten westlichen Athleten bergen eine smarte Trainingssteuerung wie das richtige Timing zentraler Trainingseinheiten, das frühzeitige Erkennen von Verletzungsrisiken und eine kluge Rennstrategie durch ihre oft besser ausgebildeten Trainer eine große Chance, ihre anatomischen Nachteile zu kompensieren.
Ein tolles Beispiel für das konsequente Vereinen der afrikanischen mit der europäischen Laufwelt ist der Schweizer Halbmarathon-Europarekordler Julien Wanders, der schon in jungen Jahren in Eigenregie nach Kenia gezogen ist und sich dort eine afrikanische Trainingsgruppe aufgebaut hat. Auf 2400 Metern über dem Meerespiegel kombiniert er den strukturierten westlichen Trainingsansatz mit den Vorteilen, in einer starken Gruppe bei besten klimatischen Bedingungen zu trainieren und fuhr damit beachtliche Erfolge ein. Bände sprechen auch die enormen Erfolge eingebürgerter afrikanischer Athleten, die vor allem unter dem Dach europäischer Verbände enorme internationale Erfolge einfahren, da sie ihr anatomisches Talent mit den professionelleren europäischen Strukturen inklusive einer guten Förderung kombinieren können. So belegten im vergangenen Jahr beim olympischen Marathon gleich zwei eingebürgerte Afrikaner Medaillenränge: Abdi Nageeye für die Niederlande und Bashir Abdi für Belgien. Der wohl bekannteste japanische Marathonläufer Suguru Osako ist ebenfalls ein Athlet, der den Mut hatte, einen großen Schritt ins Ausland zu wagen. Der Olympiasechste hat sich viele Jahre lange dem amerikanischen Oregon Project angeschlossen und von der optimalen Infrastruktur sowie Trainingspartnern auf Weltniveau profitiert.

Offensichtlich gilt: Einen Königsweg zum Erfolg gibt es im Laufsport nicht. Doch es fällt auf, dass sich die meisten Stars in diesem Sport nicht nur auf ihr Talent besinnen, sondern es zusätzlich mit professionellen Strukturen unterfüttern und ihr Umfeld aktiv verbessern. Dass beispielsweise bei den letzten Olympischen Spielen im Marathon acht verschiedene Nationen – darunter drei Läufer nichtafrikanischer Herkunft - unter den Top 10 vertreten waren, zeigt, dass trotz der nicht zu verkennenden afrikanischen Dominanz Läufer mit verschiedenen Karriereentwürfen nach ganz oben vordringen können.